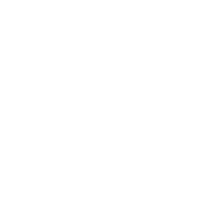Manfred Komorowski und Hanspeter Marti:
Königsberger Universitätsschriften und Promotionen vom Gründungsjahr der Albertina 1544 bis 1800 / Dissertationen und Habilitationsschriften 1801 bis 1885, 1886 bis 1905
Datenbank
Manfred Komorowski und Hanspeter Marti: Königsberger Universitätsschriften und Promotionen vom Gründungsjahr der Albertina 1544 bis 1800. Eine Datenbank.
Ziel des Projektes ist die vollständige bio-bibliographische Erfassung und Erschließung des an der Universität Königsberg entstandenen akademischen Schrifttums aller vier Fakultäten seit der Gründung der Universität bis zum Jahre 1800. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Dissertationen und akademische Reden sowie um Programmschriften, welche die Behandlung eines bestimmten Themas anzeigen. Die bio-bibliographische und inhaltliche Erschließung dieser Literaturgattungen stellt einen wichtigen Schritt in der Aufarbeitung gedruckter Quellen zur Königsberger Universitätsgeschichte und darüber hinaus zur geistigen Kultur Königsbergs und Ostpreußens in der Frühen Neuzeit dar. Ein vergleichbares Vorhaben ist bislang noch für keine herausragende Universität des alten deutschen Sprachraums initiiert worden; insofern besitzt das Projekt exemplarischen Charakter. Angesichts des singulären Schicksals der Königsberger Bibliotheken nach 1945 leistet das Vorhaben zugleich einen entscheidenden Beitrag zur Rekonstruktion eines versunkenen regionalen Kulturraums und wird zukünftiger kulturraumbezogener geisteswissenschaftlicher Forschung ebenso wie wissenschaftsgeschichtlichen Forschungsansätzen vielfach seit Jahrzehnten verschollene Quellen erstmals wieder zugänglich machen.
Etwa 2200 Dissertationentitel des 17. Jahrhunderts wurden in jahrelanger Arbeit von Manfred Komorowski zusammengetragen und bildeten die Basis der Datenbank. Komorowski, der unserer Arbeitsstelle seine gewaltige Vorarbeit und seine Kenntnisse dankenswerterweise zur Verfügung stellt, ist einer der wenigen Spezialisten für die Geschichte des frühneuzeitlichen Disputationswesens im deutschen Sprachgebiet. Durch internationale Kooperation konnte die Arbeitsstelle die Datenbank inzwischen um Titel des 18. Jahrhunderts erweitern. Auch die Dissertationen des 16. Jahrhunderts werden aufgenommen. Seit 2016 ergänzt Daria Barow-Vassilevitch, Berlin, die Datenbank um Standortnachweise in russischen Bibliotheken.
Manfred Komorowski: Königsberger Dissertationen, Promotionen und Habilitationsschriften 1801 bis 1885, 1886 bis 1905. Erweiterung der bestehenden Datenbank.
Am 6. November 1885 bestimmte das preußische Kultusministerium per Erlass, dass künftig alle auf Veranlassung von Hochschulen herausgekommenen Schriften jährlich im neu geschaffenen Jahresverzeichnis der an den deutschen Universitäten erschienenen Schriften anzuzeigen seien. Damit setzte ab August 1885 eine fortlaufende, systematische Berichterstattung über das Universitätsschrifttum ein, von der bis dahin nicht die Rede sein konnte und die neben den Dissertationen und Habilitationsschriften auch Vorlesungs- und Personenverzeichnisse, Statuten und Gelegenheitsschriften vollständig nachweisen sollte. Bis heute ist die bibliographische Situation dadurch gekennzeichnet, dass längst nicht alle der im 19. Jahrhundert bereits existierenden Universitäten über Verzeichnisse ihrer Schriften vor 1885 verfügen. Berlin, Bonn und Breslau schlossen diese Lücken um 1900 und konnten dabei auf eine damals noch völlig intakte literarische Überlieferung in ihren Archiven und Bibliotheken zurückgreifen. Danach dauerte es über ein halbes Jahrhundert, bis Halle hinzukam. Gießen, München, Würzburg und Erlangen vervollständigten das Bild erst in jüngerer Zeit. Für alle anderen Universitäten gibt es bis heute keine entsprechenden Bibliographien.
Für Königsberg wirkte es sich besonders fatal aus, dass man nicht vor 1945, vor den verheerenden Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs, die Initiative ergriffen hatte. Zwar gehören auch die Königsberger Dissertationen und Habilitationsschriften des 19. Jahrhunderts im Gegensatz zu vielen analogen Titeln aus der frühen Neuzeit nicht zu den besonders selten gewordenen Schriften, und eine Reihe von deutschen Bibliotheken besitzt recht vollständige, meist in Sammelbänden nach Fakultäten chronologisch geordnete Kollektionen. Der größere Teil der Königsberger Hochschulschriften ist also relativ schnell zusammenzubekommen. Dennoch zeigen sich bei näherer Betrachtung und vor allem für das beginnende 19. Jahrhundert immer wieder Lücken, die nur durch die Einbeziehung der archivalischen Überlieferung zu schließen sind. Gemeint sind damit vorrangig Alben der Kandidaten bzw. der Promovierten oder Promotionsurkunden.
Das Königsberger Staatsarchiv hatte seine besonders wertvollen Bestände im Zweiten Weltkrieg rechtzeitig ausgelagert. Sie gelangten über das Depot Grasleben bei Helmstedt ins Staatliche Archivlager Göttingen und dann 1979 ins Berliner Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz.
Ein auch für die Geschichte der Albertina wichtiger Teil der Königsberger Archivalien wurde allerdings 1947 von der britischen Besatzungsmacht an das damalige Wojewodschaftsarchiv in Allenstein (Olsztyn) abgegeben, wo die Akten lange Jahre für westliche Forscher unzugänglich blieben, heute aber mühelos dort einzusehen sind.
Die ersten Vorarbeiten zu diesem Projekt gehen bis ins Jahr 1988 zurück, als das Verzeichnis Promotionen an der Universität Königsberg 1548-1799 herauskam. Eine Fortsetzung der bibliographischen Verzeichnung Königsberger Universitätsschriften über das Jahr 1799 hinaus erschien sehr lohnend und wünschenswert. Recherchen in der Bibliothek der Humboldt-Universität Berlin, der größten deutschen Dissertationensammlung, der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen sowie in der Universitätsbibliothek Erlangen ergaben schon eine sehr vollständige Kollektion. Ein ganz wichtiges bibliographisches Hilfsmittel war die von 1864 bis 1885 in der Altpreußischen Monatsschrift laufend publizierte Universitäts-Chronik (siehe: Bio-bibliographische Nachweise). Ist somit jener Berichtszeitraum optimal abgedeckt, gestaltet sich die Suche nach früheren Titeln trotz der erwähnten Bibliotheksbestände schon schwieriger. Im Gegensatz zu anderen Universitäten gab es in Königsberg bis 1854 keine ausdrücklichen Inauguraldissertationen zur Erlangung des Doktors der Philosophie. Die Graduierung erfolgte auf Grund früherer Schriften oder auch ehrenhalber. Auch an den Königsberger Universitätsschriften kann man in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts den Übergang vom frühneuzeitlichen Disputationswesen mit den Übungsdissertationen, den dissertationes pro gradu, pro receptione oder pro loco zur einheitlichen Inauguraldissertation für den Doktortitel bzw. pro venia legendi als Habilitationsleistung feststellen. Mit der nunmehr erfolgten Einspeisung der Magisterpromotionen vor 1800 (ohne Dissertationen) sowie der Titel des 19. Jahrhunderts ist das Königsberger Universitätsschrifttum vor 1900, mit Ausnahme der Programme und Vorlesungsverzeichnisse, recht vollständig nachgewiesen.
Benutzerhinweise
Die Herkunft der Respondenten, kann, soweit sie bekannt ist, über das Feld Respondent / Promovend recherchiert werden. Nach 1850 gibt es Habilitationsschriften, bei denen der Kandidat nur als Habilitand, nicht aber als Präses, ohne Respondent, erscheint. Auf solche Fälle bezieht sich im Feld Präses / Habilitand der Zusatz Habilitand.
Im Feld Beiträger werden die Verfasser von Gratulationen und, soweit auf den Titelblättern der Dissertationen erwähnt, die Opponenten genannt. Im Feld Bibliothek finden sich Standortnachweise, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben können.
Die Angaben im Feld Bio-bibliographische Nachweise sind Abkürzungen, die im gleichnamigen Verzeichnis ausführlich bibliographiert sind. Dieses greift vorwiegend auf die grossen nationalen biographischen Archive zurück, gibt aber nicht die dort ausgewerteten Primärquellen an.
Im Feld Fakultät werden die Dissertationen nach ihrer Zugehörigkeit zu einer der vier traditionellen Fakultäten (Theologie, Jurisprudenz, Medizin, Philosophie) erfasst.
Dissertationen, von denen nur fragmentarische Angaben vorliegen, werden in die Datenbank aufgenommen. Die Arbeitsstelle ist für bibliographische Ergänzungen und Standortnachweise dankbar.
Die Namen der eingetragenen, an der Universität Königsberg promovierten Magister können ermittelt werden, indem man unter Suchen nach auf Titel klickt und ins Suchfeld "Magisterpromotion" eingibt.